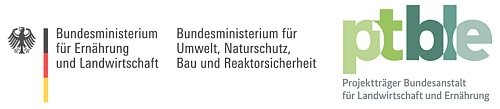bioProtect
Entwicklung und Implementierung biotechnischer Verfahren der insektizidfreien Borkenkäferregulation durch Nutzung und Steuerung natürlicher Borkenkäferantagonisten als Massnahmen zum Erhalt der Biologischen Vielfalt und der damit verbundenen CO2-Senkenfunktion
Verbundprojekt, Laufzeit 2015 - 2018
Projektpartner:
Georg-August-Universität Göttingen
Abteilung Forstzoologie und Waldschutz
Prof. Dr. Stefan Schütz
Technische Universität Dresden
Institut für Waldbau und Waldschutz
Prof. Dr. Michael Müller
Vorhabensbeschreibung:
Im Rahmen eines naturnahen Waldschutzes soll das Projekt dazu dienen, naturnahe und umweltverträgliche biotechnische Verfahren zur Steuerung und Regulation von Borkenkäferpopulationen weiterzuentwickeln sowie deren Implementierung unter Praxisbedingungen zu erproben. Die Verwertung der zu entwickelnden Verfahren bezieht sich einerseits auf die Vermeidung von Borkenkäferbefall und andererseits darauf, dass aus Bäumen oder Rohhölzern, die von Borkenkäfern bereits besiedelt sind, keine Borkenkäfernachkommenschaft entsteht. Während der erste Aspekt vor allem in Wirtschaftswäldern relevant ist, betrifft der zweite Aspekt sowohl Wirtschaftswälder als auch bewirtschaftungsfreie Wälder bis hin zu Einzelbäumen (jeweils einschließlich Rohholzlager, Schadhölzer, Totholzvorkommen und dgl.), von denen vorrangig keine Borkenkäferausbreitung ausgehen soll. Aus den zu entwickelnden Managementverfahren werden sich auch neue Möglichkeiten im Monitoring von Borkenkäferarten ableiten lassen. Dies betrifft sowohl eine Vielzahl von Borkenkäferarten, welche in den zunehmenden Laubwaldstrukturen der Wälder künftig vermehrt auftreten werden und zu wirtschaftlichen Schäden führen können, als auch invasive Arten mit Gefahrenpotenzial für Waldökosysteme.
Mit dem geplanten Vorhaben werden die bestehenden Verfahren hinsichtlich des Spektrums einzusetzender Substanzen weiter optimiert und erstmals großflächige Praxistests durchgeführt. Die aus dem Projekt abzuleitenden Ergebnisse sind für eine Überführung der Verfahren in die Praxis essenziell. Deshalb soll aus den Ergebnissen durch die Kooperationspartner ein Praxisleitfaden mit Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, welcher Alternativen zum bisher üblichen Insektizideinsatz im Borkenkäfermanagement aufzeigt. Durch diesen sollen neben den zu erzielenden Wirkungsgraden auch der ökologische Mehrwert, welcher durch naturnahe Verfahren erreicht werden kann, sowie die positiven Rückkopplungen auf die biologische Vielfalt (Nützlingsförderung, Nebenwirkungsvermeidung) und die damit verbundene Anpassungsfähigkeit der Wälder an den Klimawandel dargestellt und thematisiert werden.
Gefördert durch das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.